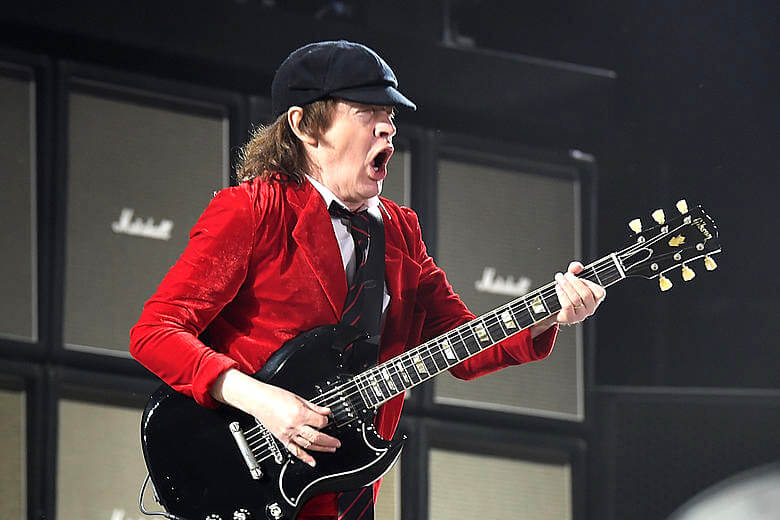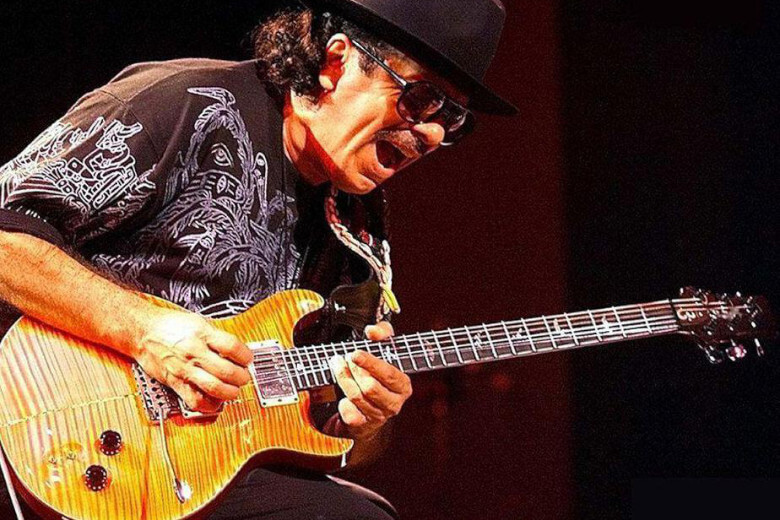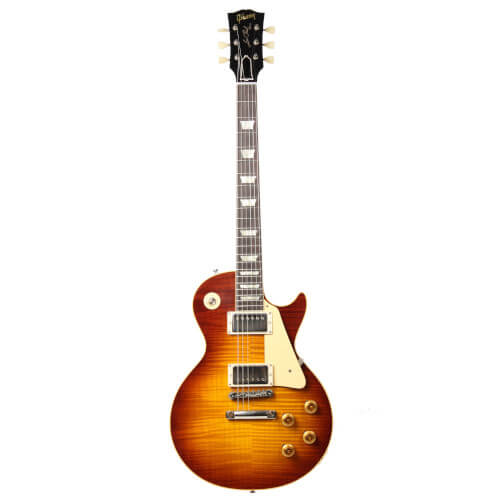Michael Kevin „Mick“ Taylor, geboren am 17. Januar 1949 in Welwyn Garden City, England, wuchs in Hatfield, Hertfordshire auf. Sein Vater schraubte Flugzeuge zusammen, Mick schraubte Gitarre. Mit neun Jahren begann er, das Instrument vom jüngeren Bruder seiner Mutter (einen sogenannten Onkel) zu lernen. Schon als Teenager gründete er Bands, trat im Fernsehen auf und veröffentlichte eine Single. Er war neugierig, ehrgeizig und – typisch Teenager – ein bisschen zu früh dran für die ganz großen Bühnen.
1965, mit 16, stolperte er buchstäblich in sein erstes Karriere-Highlight: ein Konzert von John Mayall’s Bluesbreakers. Eric Clapton war nicht da. Mick schnappte sich seine Gitarre, spielte den zweiten Satz und verdiente sich Mayalls Respekt. Das war der Moment, in dem ein Teenager aus Hertfordshire das erste Mal das Gefühl hatte, dass seine Zukunft durchaus laut werden könnte. Ein Jahr später war er offiziell bei den Bluesbreakers, wo er zwischen 1966 und 1969 seinen Stil perfektionierte:
Blues als Fundament, Latin und Jazz als würzige Extras, später kam die Slide-Gitarre hinzu. Alben wie Crusade, Diary of a Band und Blues from Laurel Canyon tragen sein Gitarrensiegel. 1969 schien das Leben für Taylor plötzlich wie ein Hollywood-Drehbuch: Brian Jones weg, John Mayall empfiehlt ihn Mick Jagger, und bevor er sich versieht, spielt er mit den Rolling Stones. Taylor dachte, er würde nur ein Sessiongitarrist sein – am nächsten Tag war er schon auf der Bühne, Overdubs für Let It Bleed und Honky Tonk Women inklusive.
Sein Bühnendebüt: das kostenlose Hyde-Park-Konzert am 5. Juli 1969. Eine Viertelmillion Menschen, und Mick Taylor, gerade 20, mittendrin. In den folgenden fünf Jahren lieferte Taylor auf Alben wie Sticky Fingers, Exile on Main St. und Goats Head Soup flüssige, melodische Gitarrenlinien, die sich von Keith Richards‘ kantiger Spielweise abhoben. Er schrieb mit Jagger Songs wie „Sway“ und „Moonlight Mile“ – nur um zu erleben, dass Songwriting-Credits eine willkürliche Währung waren.
Das Ergebnis: Frust, Drogenprobleme in der Band und Taylor, der sich entschloss zu gehen. Sein Abschied im Dezember 1974 war kein Drama, aber auch kein Spaziergang: eine Party in London, ein kurzes Gespräch mit Jagger, und er war weg. Kein Streit, nur der unbändige Drang, sich selbst und seine Musik zu retten. Taylor selbst sagt es so: „Ich hatte nie das Gefühl, für immer bei den Stones zu bleiben, nicht einmal von Anfang an. Ich wusste nur, dass ich raus musste, bevor ich selbst verloren gehe.“
Die Jahre nach 1974 waren ein Shitstorm aus Projekten, Reisen und kreativen Abenteuern. Mit Jack Bruce, Carla Bley, Bruce Gary oder Little Feat experimentierte er, tourte durch Europa, entdeckte Brasilien und die Musik des Amazonas. 1977 unterschrieb er einen Solovertrag bei Columbia Records, veröffentlichte 1979 sein Album Mick Taylor – ein Mix aus Rock, Jazz und lateinamerikanischen Bluesfarben. Die 1980er Jahre brachten Arbeit mit John Mayall, Bob Dylan und Alvin Lee. Taylor kämpfte privat mit seinen verdammten Suchtproblemen, fand aber zurück zur Musik.
1990 veröffentlichte er Stranger in This Town und tourte weltweit, begleitet von exzellenten Musikern. Er spielte auf Alben von Joan Jett, Dramarama, Percy Sledge, Barry Goldberg und Carla Olson, immer als der Gitarrist, der zu hören ist, wenn man auf geschmeidige, fast zu perfekte Melodien steht. Obwohl Taylor die Band verließ, kehrte er immer wieder zu seinen alten Kollegen zurück – auf Studio- und Konzertbühnen.
2012 und 2013 trat er bei den Jubiläumskonzerten der Stones auf, 1989 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Mick Taylor bleibt eine Legende unter Gitarristen, sein Einfluss auf Slash und viele andere beweist: Talent erkennt man, auch wenn man gerade nicht im Rampenlicht steht. Taylor ist nie der Showman gewesen, den man auf jeder Bühne gesehen hat. Er ist der Musiker, der in den leisen Momenten aufblitzt, der Spieler, der zwischen Blues, Jazz und Rock jongliert und dabei eine Leichtigkeit vermittelt, die viele ewig suchen.