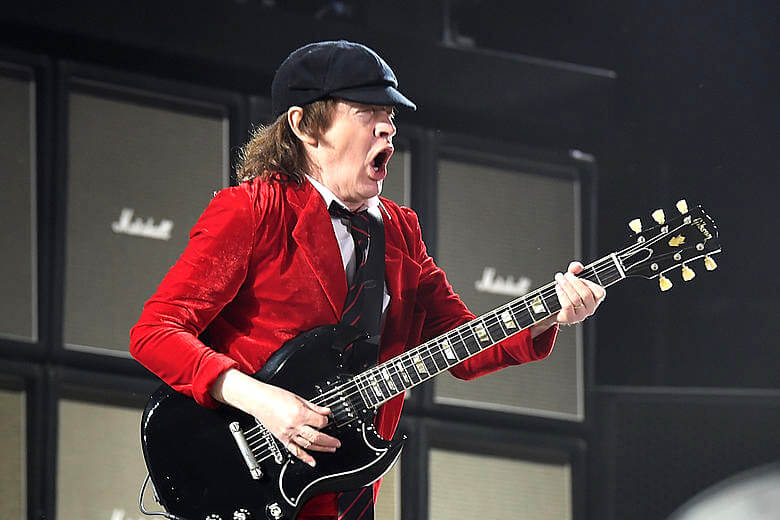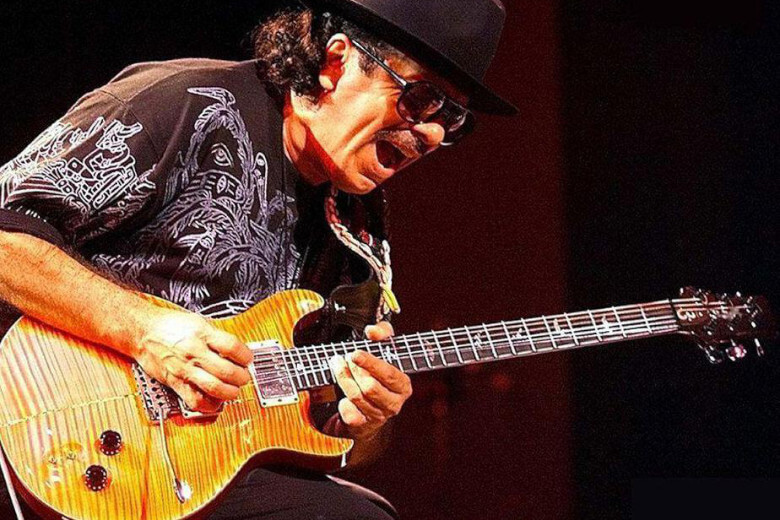Eric Patrick Clapton kam nicht wie normale Kinder in einem Krankenhaus zur Welt, sondern im Wohnzimmer seiner Großeltern in Ripley, Surrey. Schon sein erster Schrei klang mehr nach Bluesnote als nach Babygeplärre. Seine Mutter Pat war 16, sein Vater – ein kanadischer Soldat – machte direkt nach der Schwangerschaft die Biege. Statt elterlicher Geborgenheit bekam Clapton also eine Familien-Satire vom Feinsten: Oma und Opa zogen ihn groß, während seine Mutter offiziell als seine „Schwester“ durchging. Willkommen bei „Clapton – Season 1: Die große Identitätslüge“.
Natürlich flog das irgendwann auf. Als kleiner Junge dachte Eric wirklich, er sei ein ganz normales Kind. Doch mit neun Jahren platzte die Bombe: „Ach übrigens, deine Schwester ist eigentlich deine Mutter.“ Zack, Weltbild pulverisiert. Kein Wunder, dass er danach in der Schule mehr wie ein brütender Außenseiter wirkte, anstatt ein Klassenclown zu sein. Wenn du als Kind lernst, dass deine Familie ein Live-Action-Mindfuck ist, dann ist Matheunterricht plötzlich das kleinere Problem. Doch Clapton hatte einen Ausweg: Musik.
Seine Großmutter klimperte Klavier, im Radio lief Big Band, und irgendwo zwischen all dem hörte Eric diese schwarzen Magier aus Amerika: Muddy Waters, B.B. King, Buddy Guy. Und es machte „Klick“. Mit 13 bekam er seine erste Gitarre, eine billige deutsche Hoyer. Das Teil war so unspielbar, dass Clapton sie fast direkt wieder in die Ecke warf. Aber der Blues bohrte sich schon tief genug in seinen Kopf, dass er einfach weitermachte. Mit 16 landete er am Kingston College of Art – offiziell, um Kunst zu studieren. Inoffiziell, um alles mit Gitarre zu übertönen, was nicht nach Blues klang.
Ein Jahr später schmiss die Schule ihn raus, weil er mehr mit Bendings als mit Bleistiften beschäftigt war. Seine Eltern wollten, dass er „vernünftig“ wird – also half er als Bauarbeiter mit. Aber Clapton hatte längst den Soundtrack für seinen Ausbruch gefunden. Sein Weg auf die Bühne begann klein: Erst Straßenmusik in Kingston, dann mit The Roosters 1963 seine erste richtige Band. Clapton war 17, die Band existierte ein knappes Jahr, und danach tingelte er kurz bei Casey Jones & The Engineers herum. Alles kleine Aufwärmrunden für das, was bald kommen sollte.
Denn 1963 riefen die Yardbirds an – eine Band, die zu dem Zeitpunkt niemandem außerhalb Londons groß etwas sagte. Clapton stieg ein, und innerhalb von 18 Monaten war er das Wunderkind mit Gitarre. Dort bekam er seinen berühmten Spitznamen: „Slowhand“. Nicht, weil er langsam spielte, sondern weil er auf der Bühne so lange brauchte, um seine Saiten zu wechseln, dass das Publikum gelangweilt im Slow-Clap verfiel. Aus Spott wurde Mythos – und aus dem schüchternen Burschen wurde eine lokale Legende. Clapton aber blieb ein Sturkopf. Die Yardbirds schwenkten auf einen poppigeren Sound um, wollten Hits statt reinen Blues – und Clapton sagte: „Nope, ich bin raus.“ Stattdessen ging er zu John Mayall’s Bluesbreakers, und hier explodierte sein Ruf.
Claptons Gitarrensound auf dem legendären „Beano“-Album war so roh, dass Kids in London „Clapton is God“ an Wände sprayten. Und plötzlich war er nicht nur ein Typ mit einer Gitarre, sondern ein verdammter Prophet mit Verstärker. Aber Clapton wäre nicht Clapton, wenn er nicht nach kurzer Zeit wieder die Koffer gepackt hätte. 1966 gründete er mit Jack Bruce und Ginger Baker die Supergroup Cream – und das war so etwas wie die Marvel-Avengers des Blues-Rock. Drei Egos, drei Genies, drei Typen, die sich gegenseitig auf der Bühne in Grund und Boden solieren wollten.
Das Ergebnis: eine Mischung aus göttlicher Musik („Sunshine of Your Love“, „White Room“) und interner Hölle. Zwei Jahre später war Cream Geschichte, aber Clapton stand endgültig auf dem Olymp. Er hatte sich aus dem Wohnzimmerdrama eines kleinen englischen Dorfes zur Gitarren-Ikone der 60er hochgespielt. Der Junge, der dachte, seine Mutter sei seine Schwester, war jetzt der Typ, dessen Fans ihn für Gott hielten. Willkommen bei „Clapton – Season 2: Vom Bastardkind zum Blues-Messias“.